
Begutachtung von Behandlungsfehlern
Wenn passiert, was nicht passieren sollte
Behandlungsfehlerbegutachtung – dieser Begriff mag auf den ersten Blick sehr abstrakt klingen. Dabei handelt es sich um ein sehr konkretes, ernstes und wichtiges Thema – vor allem für die Betroffenen. Denn Behandlungsfehler können mitunter schwerwiegende dauerhafte Gesundheitsschäden hinterlassen. Der Medizinische Dienst prüft daher im Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen vermutete Behandlungsfehler bei Versicherten und erstellt dazu bundesweit pro Jahr knapp 14.000 fachärztliche Gutachten.
Im folgenden Interview erklärt Dr. Michael Schmuck, unser Fachreferent für medizinisch-juristische Fragen, wie diese Begutachtung abläuft und welche Maßnahmen er sich für mehr Patientensicherheit und Versorgungsqualität in Deutschland wünscht.
Lieber Herr Dr. Schmuck, können Sie uns zu Beginn kurz erläutern, wie die Behandlungsfehlerbegutachtung abläuft und was wir als Medizinischer Dienst damit zu tun haben?
Schmuck:
Wenn Versicherte vermuten, dass ihrem Arzt oder ihrer Ärztin in der Behandlung ein Fehler unterlaufen ist, können sie sich an ihre Krankenkasse wenden. Diese veranlasst dann eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst.
An dieser Stelle ist meine Abteilung für medizinisch-juristische Fragen gefordert. Um zu klären, ob bei der Behandlung ein Fehler aufgetreten ist, rekonstruieren unsere Gutachterinnen und Gutachter das Behandlungsgeschehen anhand der Behandlungsunterlagen. Im Anschluss gleichen sie diesen Verlauf anhand medizinischer Leitlinien und wissenschaftlicher Literatur mit den Standards ab, die zum Behandlungszeitpunkt galten. Vor diesem Hintergrund treffen sie dann ihre Beurteilung. Neben der jeweiligen Kasse erhalten in der Regel auch die Versicherten das entsprechende Gutachten. Auf dieser Grundlage können sie sich dann mit ihrer Krankenkasse beraten und gegebenenfalls Schadensersatzansprüche formulieren.
Im August 2024 hat unser Dienst zuletzt die Zahlen für das Vorjahr bekanntgegeben. Können Sie diese für uns zusammenfassen?
Schmuck:
Wir haben im Jahr 2023 insgesamt 1.447 Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern erstellt und dabei in rund einem Drittel der Fälle (489) Behandlungsfehler festgestellt. Den für einen möglichen Schadensersatz wichtigen Ursachenzusammenhang zwischen Fehler und entstandenem Schaden haben wir bei 454 Fällen bestätigt. Das Spektrum der Fehler ist breit gefächert. Es betrifft also die unterschiedlichsten Erkrankungen und Behandlungen. Im Jahr 2024 lagen die Zahlen und das Spektrum der Fehler auf dem gleichen Niveau. Im Sommer 2025 werden wir dazu wieder öffentlich berichten.
Wie sind diese Zahlen zu bewerten? Welche Entwicklungen nehmen Sie wahr, insbesondere im Hinblick auf Behandlungssicherheit und Versorgungsqualität?
Schmuck:
Die Begutachtungsergebnisse liegen insgesamt in dem seit Jahren üblichen Rahmen. Sie waren also ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Ich muss aber dazu sagen: Die Zahlen des Medizinischen Dienstes sind nicht repräsentativ und spiegeln nur einen Ausschnitt der Behandlungsfehler wider! Deshalb ist es schwer, aus unseren Zahlen grundsätzliche Aussagen über die Behandlungssicherheit und Versorgungsqualität in der Region oder in ganz Deutschland abzuleiten.
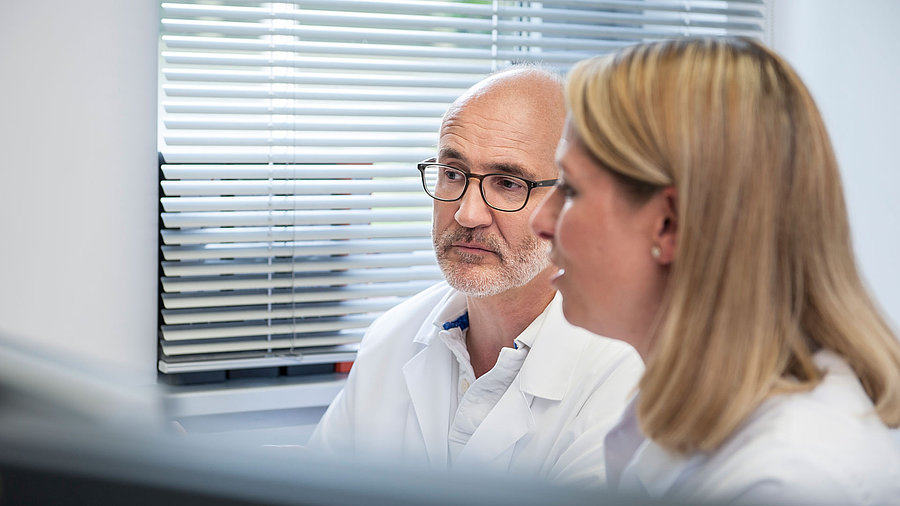
Wie könnte Ihrer Meinung nach das Bewusstsein für das Thema Behandlungsfehler gestärkt werden? Was braucht es da zukünftig?
Schmuck:
Ich bin der Überzeugung, dass es gesamtgesellschaftlich noch mehr Transparenz geben muss, was Behandlungsfehler angeht. Erst, wenn alle Beteiligten offen darüber sprechen, bekommen wir auch belastbare Daten, auf deren Grundlage wir systematische Verbesserungen und Präventionsmaßnahmen einleiten können. Einige Krankenhauskonzerne arbeiten in dieser Hinsicht schon sehr vorbildlich und gehen offen und selbstkritisch mit ihren Fehlern um.
Wozu wir aktuell kaum Zahlen haben, sind sogenannte Never Events. Das sind seltene, aber mitunter schwerwiegende, vermeidbare Schadensereignisse: Patienten-, Seiten- und Medikamentenverwechslungen oder zurückgebliebenes Operationsmaterial im Körper. Solche Fehler deuten in der Regel auf systemisches Versagen hin, weil Checklisten und Markierungen bei Eingriffen nicht eingehalten wurden.
Die Krankenhausreform bietet eine Möglichkeit, hier ein strukturiertes Meldesystem etablieren. Der bereits vorhandene Bundes-Klinik-Atlas könnte beispielsweise um krankenhausbezogene Informationen zu Never Events ergänzt werden.
Herr Dr. Schmuck, Sie sind auch als Dozent auf der Bundesebene aktiv. Erzählen Sie uns zum Abschluss noch etwas zum Wissenstransfer.
Schmuck:
Insgesamt erfordert die Behandlungsfehlerbegutachtung eine Menge Expertise und Sachverstand. Oft geht es um wirklich komplexe Fragestellungen, sowohl medizinischer als auch rechtlicher Natur. Aus diesem Grund halte ich regelmäßig Schulungen bei Krankenkassen, in Kliniken oder Landesärztekammern.
Auch im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung und der Knappschaft-Bahn-See werden Behandlungsfehlervorwürfe durch entsprechende sozialmedizinische Dienste geprüft. Letztes Jahr habe ich die dort tätigen Gutachterinnen und Gutachter in die Praxis der Behandlungsfehlerbegutachtung eingeführt. Diese enge Zusammenarbeit zwischen den Medizinischen Diensten und anderen Prüfinstitutionen kommt am Ende den Versicherten zugute. Dass ich mit meiner Tätigkeit vielleicht auch einen präventiven Beitrag zur Fehlervermeidung leisten kann, gibt mir ein gutes Gefühl!